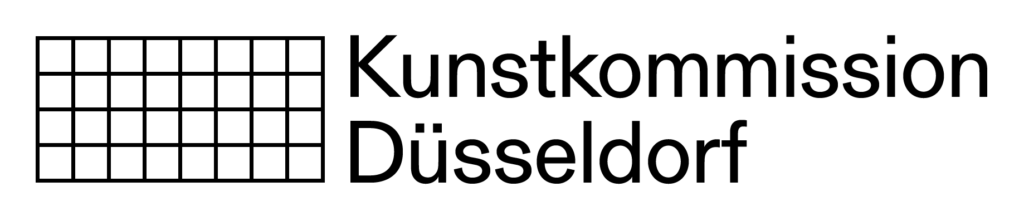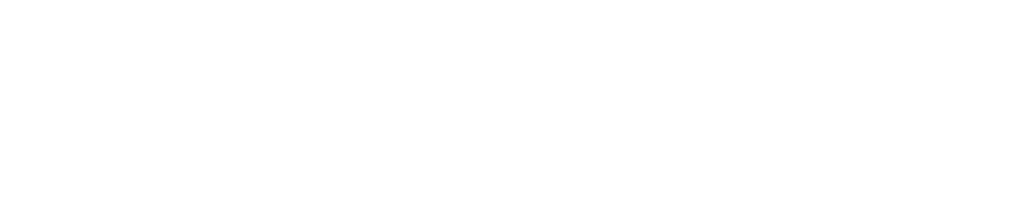Tagung der Kunstkommission der Landeshauptstadt Düsseldorf
20./21. März 2026, Künstlerverein Malkasten Düsseldorf
(for english, please scroll down)
Der öffentliche Raum stellt ein komplexes Gefüge dar, das stets neu verhandelt wird – sozial, politisch, ästhetisch und symbolisch. Angesichts zunehmender Verdichtung, gesellschaftlicher Fragmentierung und politischer Polarisierung verschärfen sich diese Aushandlungsprozesse. Dies ist auch der Fall, wenn es um die Rolle von Kunst im öffentlichen Raum geht – sei es im Rahmen der Realisierung von neuen Projekten oder im Umgang mit Bestandskunst. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die 2024 in Düsseldorf entbrannte Debatte um die Fassade des ehemaligen Audimax der Hochschule Düsseldorf, gestaltet von Günter Fruhtrunk. Der geplante Abriss des Gebäudes und die damit verbundene mögliche Demontage des Kunstwerks haben eine breite öffentliche und kulturpolitische Diskussion ausgelöst, in der städtebauliche Interessen auf Denkmalschutz und künstlerische Autor*innenschaft treffen. Auch Argumente des “Kulturkampfs” spielen in diesen Debatten eine Rolle, zwischen der Moderne und rechter Raumnahme.
Wer aber entscheidet über den Erhalt öffentlicher Kunstwerke? Welche Interessen und Machtverhältnisse bestimmen diese Entscheidungen? Und wie gestaltet sich das Verhältnis von Deutungshoheit, Zugang und Teilhabe? Die Fachtagung nimmt diese Fragen zum Anlass, um die vielschichtigen Dimensionen des öffentlichen Raums sowie die Rolle der Kunst als Medium gesellschaftlicher Mitgestaltung, Kritik und Transformation zu untersuchen. Neben dem Umgang mit Bestandskunst sollen vor allem künstlerische und kuratorische Strategien verhandelt werden, die bestehende Machtstrukturen sichtbar machen, hinterfragen oder strategisch unterwandern. Dabei liegt der Fokus auf der Praxis von Akteur*innen, die im Stadtraum weniger sichtbar sind – wie queerfeministischen Perspektiven –, ebenso wie auf Praktiken der Kollaboration als Form der Teilhabe. Des Weiteren rücken künstlerische Strategien in den Blick, die die ökologische und soziale Transformation mitgestalten, sowie Kunstprojekte, die den öffentlichen Raum ins Digitale erweitern.
Die Tagung bringt Künstler*innen, Kurator*innen, Wissenschaftler*innen und Akteur*innen der Stadtgesellschaft zusammen, um gemeinsam über die Gestaltungsspielräume und die transformative Kraft von Kunst im öffentlichen Raum zu reflektieren. Neben eingeladenen Keynote-Speaker*innen und Diskussionsteilnehmer*innen wird das Programm durch Beiträge aus einem Call for Papers ergänzt. In insgesamt fünf Panels werden die verschiedenen Dimensionen und Perspektiven von Raum verhandelt. Die ausführlichen Panelbeschreibungen finden sich angehängt.
Die Tagung findet vom 20. bis 21. März 2026 im Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf statt. Sie beginnt am Freitag um 13 Uhr und endet am Samstag gegen 14 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Tagung teilzunehmen und sich aktiv einzubringen.
Organisiert wird die Tagung von der Kunstkommission der Landeshauptstadt Düsseldorf. Seit 2018 beschäftigt sich die Kommission mit Kunst und Bau-Projekten, begleitet interdisziplinäre städtebauliche Vorhaben und richtet temporäre Formate wie den Lantz’scher Skulpturenpark sowie die international ausgeschriebenen stadt.raum.experimente aus.
Tagungspanels
Kunst im öffentlichen Raum ist nicht nur Ausdruck ästhetischer Gestaltung, sondern auch Trägerin gesellschaftlicher Werte, Narrative und Geschichtsverständnis. Viele Werke im Stadtraum sind historisch gewachsen – sie wurden in anderen politischen und sozialen Kontexten geschaffen und stoßen heute zunehmend auf Kritik, Widerspruch oder Forderungen nach Umdeutung.
Dieses Panel widmet sich der Frage, wie mit „Bestandskunst“ – also bestehenden Denkmälern und Skulpturen umgegangen werden kann und soll. Wie lassen sich problematische Inhalte oder überkommene Repräsentationsformen erkennen, diskutieren und transformieren? Welche künstlerischen oder kuratorischen Strategien des Umgangs mit diesen Arbeiten gibt es bereits – etwa Kontextualisierungen, Gegendenkmäler, temporäre Überarbeitungen oder partizipative Prozesse?
Zugleich sollen auch Fragen nach Verantwortung und Deutungshoheit gestellt werden: Wer entscheidet, was bleibt, was verändert oder entfernt wird? In welchen Verfahren und Formaten kann eine demokratische Aushandlung über Sichtbarkeit, Repräsentation und Erinnerung im öffentlichen Raum stattfinden? Ein aktuelles Beispiel bietet die in Düsseldorf entbrannte Debatte um die denkmalgeschützte Fassade des ehemaligen Audimax der Hochschule Düsseldorf, gestaltet vom Künstler Günter Fruhtrunk. Trotz ihres künstlerischen und historischen Werts steht die Fassade im Zuge geplanter Bauprojekte vor der Demontage – was breite öffentliche Proteste und kulturpolitische Diskussionen ausgelöst hat. Der Fall verweist exemplarisch auf die Spannungsfelder zwischen städtebaulicher Entwicklung, Denkmalschutz, Erinnerungskultur und künstlerischer Autonomie – und macht deutlich, wie dringend Verfahren gebraucht werden, die eine transparente und demokratische Aushandlung über Kunst im Stadtraum ermöglichen.
Insbesondere mit Blick auf den gesellschaftlichen und politischen Rechtsruck, rückt zunehmend auch die Frage nach rechtspopulistischer Raumnahme in den Fokus: Wie verändern sich die Deutungskämpfe um öffentliche Kunst in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung? Welche Gefahren birgt die Instrumentalisierung von Kunst im öffentlichen Raum für geschichtsrevisionistische Narrative – und wie können künstlerische, institutionelle und zivilgesellschaftliche Gegenstrategien aussehen?
In diesem Panel soll untersucht werden, wie sich künstlerische, performative und aktivistische Praktiken in urbanen Räumen entfalten, die durch Selbstorganisation, Protestbewegungen und kollektives Handeln geprägt sind. Der öffentliche Raum ist nicht nur Bühne für Sichtbarkeit, sondern ein umkämpfter Ort politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Hier entstehen temporäre Allianzen, kreative Widerstandsformen und alternative Öffentlichkeiten.
Wie lässt sich der Stadtraum als Handlungsraum nutzen, in dem bestehende Machtverhältnisse hinterfragt, gestört oder neu verhandelt werden? Welche Rolle spielen selbstorganisierte Strukturen – etwa Initiativen, Kollektive oder informelle Zusammenschlüsse – im Kontext künstlerisch-politischer Interventionen? Und wie bewegen sich diese zwischen institutioneller Kooperation, Autonomie und Widerstand?
Im Zentrum stehen künstlerische Strategien, die auf Teilhabe, Sichtbarkeit und Transformation zielen – sei es durch performative Aktionen, ortsspezifische Installationen oder langfristige soziale Praxis. Zugleich stellt sich die Frage, wie solche Räume geschaffen, behauptet und dauerhaft zugänglich gemacht werden können – jenseits von Projektlogik und Eventstruktur.
In diesem Panel soll die Rolle des öffentlichen Raums als Bühne für queerfeministische Un/Sichtbarkeiten untersucht werden. Wie können marginalisierter Perspektiven im städtischen Raum sichtbar gemacht und gleichzeitig bestehende Unsichtbarkeiten hinterfragt und transformiert werden? Welche Räume bieten die Möglichkeit, bestehende patriarchale Machtstrukturen zu stören und neue Formen von Präsenz und Widerstand zu etablieren? Wie kann der öffentliche Stadtraum queerfeministisch beschrieben, künstlerisch neu geschrieben und damit auch anerkannt werden?
Mit der Errichtung des LGBTIQ+-Denkmals von Claus Richter hat Düsseldorf einen wichtigen Schritt in Richtung Sichtbarkeit und Anerkennung der LGBTIQ+-Gemeinschaft gemacht. Das Denkmal stellt ein öffentliches Zeichen für Akzeptanz und Integration queerfeministischer Perspektiven im Stadtraum dar und steht für eine queere, diverse Erinnerungskultur. Doch wie kann der öffentliche Raum darüber hinaus genutzt werden, um Themenfelder wie Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und sexuelle Vielfalt zu fördern, aber auch Kontroversen wie Geschlechterrollen und historischer wie aktueller Diskriminierung zu thematisieren? Welche Strategien lassen sich entwickeln, um diese marginalisierten Themen nicht nur sichtbar zu machen, sondern als integralen Teil des urbanen Alltags langfristig zu verankern – nachhaltig und abseits von neokapitalistischen Verwertungsmechanismen in Form von “Pinkwashing”? Stichwort: “Queering Public Spaces”
Angesichts globaler ökologischer Krisen, sozialer Ungleichheit und multipler systemischer Herausforderungen stellt sich die Frage, welche Rolle Kunst im öffentlichen Raum bei der Gestaltung nachhaltiger Zukünfte einnehmen kann. Dieses Panel lädt dazu ein, künstlerische Strategien zu diskutieren, die ökologische und soziale Transformationen nicht nur thematisieren, sondern aktiv mitgestalten.
Wie kann Kunst im urbanen Raum auf Umweltfragen aufmerksam machen und kollektives ökologisches Bewusstsein fördern? Welche Rolle spielen partizipative, ortsspezifische oder prozessuale Ansätze, um alternative Formen des Zusammenlebens, Wirtschaftens und Umgangs mit Ressourcen sichtbar zu machen oder gar erlebbar zu machen? Welche Allianzen zwischen Kunst, Aktivismus und Stadtgesellschaft entstehen im Zeichen der Nachhaltigkeit – und wie lassen sich diese langfristig sichern?
Im Fokus stehen Konzepte und Projekte, die Nachhaltigkeit nicht nur als inhaltliches Thema verhandeln, sondern auch in ihrer künstlerischen Methodik reflektieren: etwa durch wiederverwendbare Materialien, kollaborative Prozesse, regenerative Praktiken oder temporäre Strukturen, die den Stadtraum neu denken. Wie können solche künstlerischen Formen Impulse für eine gerechtere, klimaresiliente Stadtentwicklung setzen – jenseits rein symbolischer Gesten?
Digitale Räume entwickeln sich zunehmend zu eigenständigen Öffentlichkeiten für künstlerische, kuratorische und kulturelle Praktiken. Dieses Panel widmet sich der Frage, wie digitale Infrastrukturen – von sozialen Medien über immersive Plattformen bis hin zu Augmented und Mixed Reality – neue Formen von Sichtbarkeit, Teilhabe und Gemeinschaft ermöglichen.
Im Fokus stehen digitale Kunstprojekte, die sich mit urbanen, gesellschaftlichen oder politischen Fragen auseinandersetzen und dabei die Grenzen zwischen physischem Stadtraum und virtuellen Handlungsfeldern verschieben. Wie kann digitale Kunst den öffentlichen Raum erweitern, kommentieren oder transformieren? Inwiefern entstehen durch ortsbezogene digitale Formate neue Perspektiven auf Stadt, Erinnerung und Gemeinschaft?
Zugleich sollen die sozialen, technischen und politischen Bedingungen dieser digitalen Öffentlichkeiten kritisch beleuchtet werden: Wer hat Zugang zu virtuellen Ausdrucksformen? Welche Barrieren bestehen durch Technologie, Algorithmen oder Plattformökonomien? Und welche Möglichkeiten eröffnen sich, über digitale Räume neue Narrative, Kollaborationen oder Formen der künstlerischen Aneignung zu erproben?
Eingeladen sind künstlerische, theoretische oder kuratorische Beiträge, die Digitalräume nicht als Gegensatz zum urbanen Raum denken, sondern als dessen Erweiterung, Spiegel oder Gegenraum – kritisch, partizipativ und ortsbezogen.
Symposium of the Art Commission of the City of Düsseldorf
20–21, 2026, Künstlerverein Malkasten Düsseldorf
Public space is a complex fabric that is constantly being renegotiated in social, political, aesthetic and symbolic terms. Amid increasing urban density, societal fragmentation, and political polarisation, these negotiation processes are intensifying. This also applies to the role of art in public space, whether in the realisation of new projects or in the treatment of existing public artworks. A recent example of this is the debate in Düsseldorf in 2024 surrounding the façade of the former Audimax at Düsseldorf University of Applied Sciences, which was designed by Günter Fruhtrunk. Plans to demolish the building and dismantle the artwork sparked a wide-ranging public and cultural-political discussion, where urban development interests clashed with heritage preservation and artistic authorship. Such debates reflect elements of today’s ‘culture wars’, particularly the conflict between modernist values and the spatial appropriation of far-right groups.
But who decides which public artworks are preserved? What interests and power structures influence these decisions? How is the relationship configured between interpretive authority, access, and participation? Taking these questions as a starting point, the symposium will explore the multifaceted dimensions of public space and the role of art as a medium for social co-creation, critique, and transformation. As well as examining existing public artworks, we will discuss artistic and curatorial strategies that expose, question, or strategically subvert existing power structures. Particular focus will be given to the practices of underrepresented groups in urban spaces, such as queer-feminist perspectives, and to collaborative practices as a form of participation. We will also explore artistic strategies that contribute to ecological and social transformation, as well as art projects that extend public spaces into the digital realm.
The symposium brings together artists, curators, researchers, and civic actors to consider how public spaces can be shaped, and to reflect on the transformative power of art in urban environments. In addition to invited keynote speakers and panellists, contributions from a call for papers will supplement the programme. The symposium comprises five panel discussions, each addressing a different dimension of spatial negotiation. The full panel descriptions are attached below.
The symposium takes place from March 20–21, 2026 at Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf. It will start on Friday 20 March at 1 pm and end on Saturday 21 March at around 2 pm. All interested citizens are warmly invited to participate in the conference and actively engage.
The symposium is organized by the Art Commission of the City of Düsseldorf. Since 2018, the Art Commission has been engaged with public art and building projects, supports interdisciplinary urban planning initiatives, and organizes temporary formats such as the Lantz’scher Skulpkturenpark and the internationally tendered stadt.raum.experimente.
Panels
Art in public space not only expresses aesthetic design, but also carries societal values, narratives and historical perspectives. Many artworks in urban space have developed historically. Created in specific historical contexts, they are now increasingly subject to criticism, disagreement, or demands for reinterpretation.
This panel will explore how to approach existing art, such as monuments and sculptures in public space. How can problematic content or outdated forms of representation be identified, discussed and transformed? What artistic or curatorial strategies already exist for dealing with these works? Examples include contextualisation, counter-monuments, temporary alterations and participatory processes.
We will also ask: who holds responsibility and interpretive authority? Who decides what should remain, what should be changed, and what should be removed? In which formats and through which processes can democratic negotiations about visibility, representation and memory take place in public spaces? One current example is the debate in Düsseldorf concerning the listed façade of the former Audimax designed by Günter Fruhtrunk. Despite its artistic and historical value, the façade is set to be demolished as part of urban development projects, sparking significant public protests and cultural-political discourse. This case highlights the tension between urban development, heritage preservation, memory culture and artistic autonomy, and emphasises the need for transparent, democratic processes when dealing with public art.
In light of the social and political shift to the right, the question of the appropriation of space by right-wing populists is becoming increasingly pertinent. How do interpretive conflicts around public art change in times of polarisation? What dangers arise from art being used to promote revisionist narratives? What artistic, institutional or civic counter-strategies can be developed?
This panel examines artistic, performative and activist practices in urban spaces that are shaped by self-organisation, protest and collective action. Public space is not only a stage for visibility; it is also a contested arena for political and social engagement. Temporary alliances, creative forms of resistance and alternative publics are formed here.
How can urban space be used to challege, disrupt, or renegotiate power structures? What role do self-organised structures, such as initiatives, collectives or informal networks, play in artistic-political interventions? And how do these navigate between institutional cooperation, autonomy, and resistance?
At the center of this discussion are artistic strategies that encourage participation, visibility and transformation, whether through performative actions, site-specific installations or long-term social practices. We will also consider how such spaces can be created, sustained and made accessible beyond project- or event-based logic.
This panel focuses on public space as a stage for queer-feminist (in)visibilities. How can marginalised perspectives be made visible in urban space, while challenging and transforming existing invisibilities? Which spaces allow for the disruption of patriarchal power structures and the establishment of new forms of presence and resistance? How can urban public space be described, rewritten and recognised from a queer-feminist standpoint?
The installation of the LGBTIQ+ monument by Claus Richter in Düsseldorf is a significant step towards the visibility and recognition of queer-feminist communities. The monument symbolises a public commitment to the inclusion and integration of queer-feminist perspectives in urban spaces, representing a diverse, queer culture of remembrance. But how can public space also promote equality, self-determination and sexual diversity, and address issues such as gender roles and historical and ongoing discrimination? What strategies can ensure these marginalised issues become embedded in everyday urban life without being co-opted by neoliberal commodification, such as ‘pinkwashing’? Keyword: “Queering Public Space”.
In light of global ecological crises, social inequality and multiple systemic challenges, this panel asks: What role can art in public space play in shaping sustainable futures? We invite discussion on artistic strategies that address and actively contribute to ecological and social transformation.
How can public art raise awareness of environmental issues and foster collective ecological consciousness? What part do participatory, site-specific, or process-based approaches play in making alternative ways of living, economic systems, and resource use visible—or even tangible? Which alliances are emerging between art, activism and urban society in the name of sustainability, and how can these be secured in the long term?
We will explore projects that incorporate sustainability in both their content and artistic methods, such as the use of reusable materials, collaborative processes, regenerative practices and temporary structures that reimagine urban space. How can these artistic forms inspire more equitable and climate-resilient urban development, rather than just making a symbolic gesture?
Digital spaces are increasingly becoming independent public spheres for artistic, curatorial, and cultural practices. This panel will explore how digital infrastructures, ranging from social media and immersive platforms to augmented and mixed reality, are generating novel forms of visibility, participation, and community.
Our focus will be on digital art projects that engage with urban, social, or political issues — projects that blur the boundaries between physical and virtual public spaces. In what ways can digital art expand, critique, or transform public space? How do site-specific digital formats offer new perspectives on cities, memory, and community?
We will also critically examine the social, technological and political conditions of these digital publics: Who has access to virtual forms of expression? What barriers are created by technology, algorithms, or platform economies? What possibilities exist for using digital spaces to explore new narratives, collaborations, and modes of artistic appropriation?
We welcome artistic, theoretical or curatorial contributions that consider digital spaces to be extensions, mirrors or counter-spaces of the urban realm, rather than opposites. These contributions should be critical, participatory and site-specific.